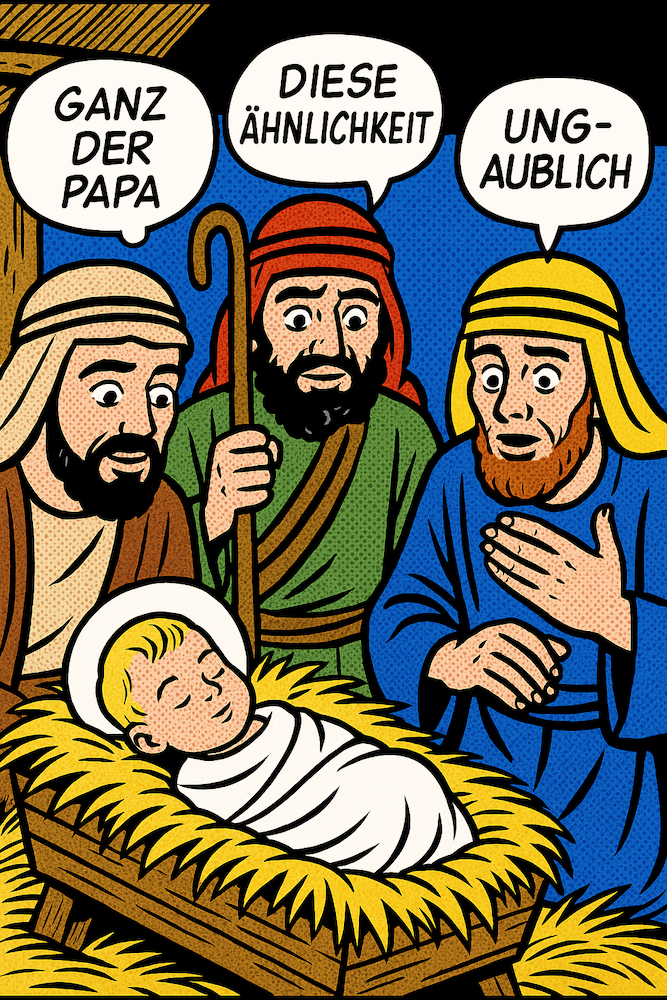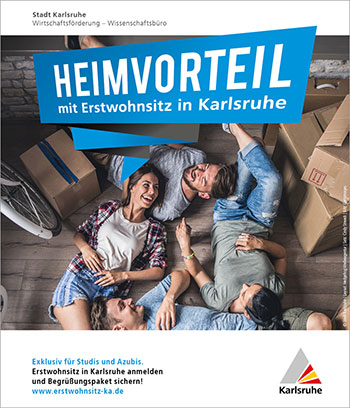Theater, Comedy, Show Theater und Show
Schauspieldirektor Claus Caesar
Es geht vor allem darum, wie wir leben wollen.
Ödön von Horvaths Gesellschaftspanorama „Geschichten aus dem Wiener Wald“ als Pop-Oper, sprachloses Theater mit einer Adaption von Aki Kaurismäkis „Das Mädchen aus der Streichholzfabrik“, „Der zerbrochne Krug“ als Western, dazu zeitaktuelle Stücke und eine Fortsetzung des überaus erfolgreichen Theatersoloformats nach Büchern von Joachim Meyerhoff - das Karlsruher Schauspiel am Badischen Staatstheaters plant mit Überraschungspotential. Böse Überraschung: das Studio als Spielstätte für experimentierfreudige kleinere Produktionen fällt wegen des Fortschritts der Großbaustelle weg. Klappe Auf unterhielt sich zum Ende seiner ersten Karlsruher Spielzeit mit Schauspieldirektor Claus Caesar.
Herr Caesar, Sie sind mit der vergangenen Spielzeit als Schauspieldirektor am Badischen Staatstheater im Team mit der Oberspielleiterin Brit Bartkowiak und zwei DramaturgInnen angetreten. Wie funktioniert die Rollenverteilung in diesem Team?
Claus Caesar: Ich finde, man kommt immer zu besseren Entscheidungen, wenn man mit anderen darüber spricht. Wir arbeiten hier gleichberechtigt und als relativ flache Hierarchie. Am Ende muss ich jedoch die Verantwortung tragen, aus dieser Rolle komme ich nicht heraus. Wobei man betonen muss, dass uns der Intendant in unserer Sparte alle Freiheiten lässt.
Wie haben Sie Karlsruhe und das Karlsruher Publikum in Ihrer ersten Spielzeit hier wahrgenommen?
Caesar: Nun, ich bin in Ludwigshafen groß geworden und kannte Karlsruhe daher schon als Kind von Zoobesuchen und was man halt als Familie bei Ausflügen so macht. Andererseits war ich schon viele Jahre nicht mehr hier, und kannte Karlsruhe daher gleichzeitig überhaupt nicht. Das Karlsruher Publikum erlebe ich als sehr zugewandt und offen mit einer großen Wachheit für Qualität. Es hat uns sehr gefreut, dass gerade die Stücke und Veranstaltungen mit politischen Stoffen und Hintergründen so gut angenommen wurden. Ich denke, dass wir da tatsächlich auf ein großes Bedürfnis und eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Themen stoßen, die uns sehr am Herzen liegen.
Welche Schwerpunkte setzen Sie in der kommenden Saison?
Caesar: Wir sind sehr froh, dass wir in der kommenden Saison wieder ästhetisch sehr unterschiedliche Ansätze und künstlerische Zugriffe hier zeigen können, was sich durch die Auswahl der Regieteams ergibt. Dadurch bietet sich dem Publikum eine große Vielfalt. Inhaltlich habe ich, je älter ich werde, immer größere Schwierigkeiten, einer Spielzeit so etwas wie eine Überschrift zu geben. Aber es geht auf der Bühne natürlich vor allem darum, wie wir leben wollen oder wie wir eben nicht leben wollen. Letztlich erweist sich die Qualität eines Spielplans an den einzelnen Arbeiten und daran, wie gelungen sie sind oder nicht.
Sie sind kein inszenierender Schauspieldirektor. Wo sehen Sie Ihre Stärken und juckt es Sie nicht doch manchmal, selbst Hand anzulegen?
Caesar: Nein, nein, inszenieren, das kann ich nicht. Ich kann auch schlecht eigene Stärken benennen, da müssten Sie die anderen fragen. Aber ich kann sagen, was ich als meine Aufgaben sehe: Vor allem Künstlerinnen und Künstlern möglichst gute Rahmenbedingungen zu stellen, damit sie und ihre Mitwirkenden gut arbeiten können. Dann halbwegs klug zu programmieren. Das geschieht bei uns in langen Diskussionen, die über Monate laufen und ergeben, was hier zu sehen sein wird. Und drittens nicht ganz zu vergessen, dass wir hier nicht vor einem leeren Saal spielen wollen, denn Theater ohne Publikum ergibt keinen Sinn.
Als Sie in Karlsruhe antraten, wurde mit viel Aufmerksamkeit bedacht, dass Sie - anders als bei Leitungswechseln im Theater sonst üblich - fast das gesamte Schauspielensemble übernommen haben. Hat sich dieser Schritt bewährt und welche Veränderungen gibt es in ihrer zweiten Spielzeit?
Caesar: Ja, wir hatten allen, die bleiben wollten, ein Angebot gemacht. Gleichzeitig haben wir das Schauspielensemble mit dem des Jungen Staatstheaters (JuSt) zusammengelegt und das Gesamtensemble ein wenig vergrößern können. Neue Begegnungen haben wir ermöglicht, indem wir darauf geachtet haben, Regieteams ans Haus zu holen, die zuvor nicht mit Anna Bergmann gearbeitet hatten. Ich denke, das bot eine gute Grundlage für Neues. Personelle Veränderungen wird es in der kommenden Spielzeit so gut wie keine geben.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Jungen Staatstheater, das sich ja das Ensemble teilt, und dem spartenübergreifenden Digitaltheater?
Caesar: Das sind sehr unterschiedliche Strukturen. Das Digitaltheater arbeitet ja mit allen Sparten, und wenn diese ein Projekt mit Schauspiel planen, schauen wir gemeinsam, mit wem wir das wie realisieren können. Mit dem JuSt ist es wesentlich komplexer, da Nele Tippelmann, die Leiterin des JuSt, und wir unabhängig voneinander programmieren und uns lediglich das Ensemble teilen. Das ist eine dispositionelle Herausforderung, auch weil das JuSt ja viel tagsüber spielt und wir abends. Wann aber bleibt dann für SpielerInnen, die auf beiden Bühnen spielen, Zeit zum Proben? Das funktioniert nur, weil wir uns so gut verstehen. Wenn beide Maximalforderungen stellen würden, ginge es nicht. Doch bei aller Einbuße von Autonomie auf beiden Seiten gewinnen wir alle einen größeren Reichtum an schauspielerischen Möglichkeiten.
Herr Caesar, Sie sind mit der vergangenen Spielzeit als Schauspieldirektor am Badischen Staatstheater im Team mit der Oberspielleiterin Brit Bartkowiak und zwei DramaturgInnen angetreten. Wie funktioniert die Rollenverteilung in diesem Team?
Claus Caesar: Ich finde, man kommt immer zu besseren Entscheidungen, wenn man mit anderen darüber spricht. Wir arbeiten hier gleichberechtigt und als relativ flache Hierarchie. Am Ende muss ich jedoch die Verantwortung tragen, aus dieser Rolle komme ich nicht heraus. Wobei man betonen muss, dass uns der Intendant in unserer Sparte alle Freiheiten lässt.
Wie haben Sie Karlsruhe und das Karlsruher Publikum in Ihrer ersten Spielzeit hier wahrgenommen?
Caesar: Nun, ich bin in Ludwigshafen groß geworden und kannte Karlsruhe daher schon als Kind von Zoobesuchen und was man halt als Familie bei Ausflügen so macht. Andererseits war ich schon viele Jahre nicht mehr hier, und kannte Karlsruhe daher gleichzeitig überhaupt nicht. Das Karlsruher Publikum erlebe ich als sehr zugewandt und offen mit einer großen Wachheit für Qualität. Es hat uns sehr gefreut, dass gerade die Stücke und Veranstaltungen mit politischen Stoffen und Hintergründen so gut angenommen wurden. Ich denke, dass wir da tatsächlich auf ein großes Bedürfnis und eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Themen stoßen, die uns sehr am Herzen liegen.
Welche Schwerpunkte setzen Sie in der kommenden Saison?
Caesar: Wir sind sehr froh, dass wir in der kommenden Saison wieder ästhetisch sehr unterschiedliche Ansätze und künstlerische Zugriffe hier zeigen können, was sich durch die Auswahl der Regieteams ergibt. Dadurch bietet sich dem Publikum eine große Vielfalt. Inhaltlich habe ich, je älter ich werde, immer größere Schwierigkeiten, einer Spielzeit so etwas wie eine Überschrift zu geben. Aber es geht auf der Bühne natürlich vor allem darum, wie wir leben wollen oder wie wir eben nicht leben wollen. Letztlich erweist sich die Qualität eines Spielplans an den einzelnen Arbeiten und daran, wie gelungen sie sind oder nicht.
Sie sind kein inszenierender Schauspieldirektor. Wo sehen Sie Ihre Stärken und juckt es Sie nicht doch manchmal, selbst Hand anzulegen?
Caesar: Nein, nein, inszenieren, das kann ich nicht. Ich kann auch schlecht eigene Stärken benennen, da müssten Sie die anderen fragen. Aber ich kann sagen, was ich als meine Aufgaben sehe: Vor allem Künstlerinnen und Künstlern möglichst gute Rahmenbedingungen zu stellen, damit sie und ihre Mitwirkenden gut arbeiten können. Dann halbwegs klug zu programmieren. Das geschieht bei uns in langen Diskussionen, die über Monate laufen und ergeben, was hier zu sehen sein wird. Und drittens nicht ganz zu vergessen, dass wir hier nicht vor einem leeren Saal spielen wollen, denn Theater ohne Publikum ergibt keinen Sinn.
Als Sie in Karlsruhe antraten, wurde mit viel Aufmerksamkeit bedacht, dass Sie - anders als bei Leitungswechseln im Theater sonst üblich - fast das gesamte Schauspielensemble übernommen haben. Hat sich dieser Schritt bewährt und welche Veränderungen gibt es in ihrer zweiten Spielzeit?
Caesar: Ja, wir hatten allen, die bleiben wollten, ein Angebot gemacht. Gleichzeitig haben wir das Schauspielensemble mit dem des Jungen Staatstheaters (JuSt) zusammengelegt und das Gesamtensemble ein wenig vergrößern können. Neue Begegnungen haben wir ermöglicht, indem wir darauf geachtet haben, Regieteams ans Haus zu holen, die zuvor nicht mit Anna Bergmann gearbeitet hatten. Ich denke, das bot eine gute Grundlage für Neues. Personelle Veränderungen wird es in der kommenden Spielzeit so gut wie keine geben.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Jungen Staatstheater, das sich ja das Ensemble teilt, und dem spartenübergreifenden Digitaltheater?
Caesar: Das sind sehr unterschiedliche Strukturen. Das Digitaltheater arbeitet ja mit allen Sparten, und wenn diese ein Projekt mit Schauspiel planen, schauen wir gemeinsam, mit wem wir das wie realisieren können. Mit dem JuSt ist es wesentlich komplexer, da Nele Tippelmann, die Leiterin des JuSt, und wir unabhängig voneinander programmieren und uns lediglich das Ensemble teilen. Das ist eine dispositionelle Herausforderung, auch weil das JuSt ja viel tagsüber spielt und wir abends. Wann aber bleibt dann für SpielerInnen, die auf beiden Bühnen spielen, Zeit zum Proben? Das funktioniert nur, weil wir uns so gut verstehen. Wenn beide Maximalforderungen stellen würden, ginge es nicht. Doch bei aller Einbuße von Autonomie auf beiden Seiten gewinnen wir alle einen größeren Reichtum an schauspielerischen Möglichkeiten.